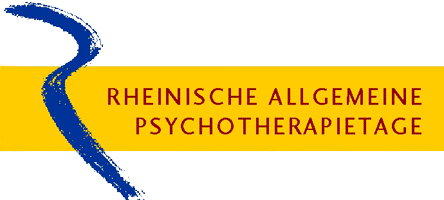- Details
- Geschrieben von: Jürgen Junglas
- Kategorie: Anne M. Lang
- Zugriffe: 2585
Anne M. Lang:
Was sind Suggestionen? Wie betreffen sie die Psychotherapie?
Vortrag 25.05.2024, Siegburg: 29. Rheinische Allgemeine PSYCHOtherapietagung: Die Verantwortung der Suggestion - inszenierte Zuversicht
Der Vortrag will für Suggestionen im Therapiezimmer sensibilisieren. Suggestionen kommen unweigerlich in jeder Interaktion und Kommunikation vor. Dadurch, dass eine Kommunikation, wenn sie die Aufmerksamkeit bekommt, den Fokus bestimmt, den sie dann weiter ausrichtet. Damit werden andere Möglichkeiten ausblendet. Kontexte bestimmen mit ihrer Rahmensetzung suggestiv auch mit, was in diesem Kontext geschehen kann. So ist ein Psychotherapiekontext suggestiv geprägt und bestimmt das, was in ihm geschieht. Das durch:
1. Die Sprache. Sie ist an sich reduzierend und kann die Komplexität von Wirklichkeit nicht mitteilen. Sie wirkt durch die Reduktion suggestiv. Sprache kann unbestimmt vage oder klar konkret sein und wirkt dadurch. Der jeweilige Zustand der Sprecher*in bestimmt das auch mit. So sind Patient*innen wenig konkret in der Zukunfts-/Zielvorstellung und dafür vage generalisierend festschreibend in der Problemfixierung. Analoge Sprachformen wie Bilder, Metaphern wirken stärker als abstrakte Worte.
2. Das „So- Gesendete“, was noch lange nicht das „So- Empfangen“ ist. Eine 1 zu 1 Vermittlung ist nicht möglich. Es gibt Appell-, Beziehungs-, Sach- und Selbstoffenbarungsseiten. Und das ist nur eine grobe Differenzierung. Suggestionen sind umso wirksamer, je mehr in der Interaktion dem Sender fachliche Autorität, Sympathie, Ähnlichkeit, Vertrauen zugesprochen wird. Suggestionen können sprachlich und interaktional indirekt oder direkt sein. Sie wirken atmosphärisch und räumlich. Unterschiedliche Verfahren haben sehr unterschiedliche Annahmen wie sie das Vorgetragene einordnen, was sie dann darauf senden und was sie nicht tun. Sie reflektieren das jedoch weniger.
3. Der Kontext. Suggestionen sind z.B. umso wirksamer je bedeutsamer der soziale Kontext der Kommunikation und je größer die Bedürfnislage ist. Psychotherapie findet im Gesundheitskontext statt, der geprägt ist von „Krankenbehandlung“.
4. Die Selbstsuggestionen. Sie sind unbeabsichtigt, automatisiert und günstig oder ungünstig. Sie betreffen sowohl Therapeut*innen als auch Patient*innen. Hier setzt u.a. therapeutische Selbstfürsorge an.
Suggestionen kommen also unweigerlich im Therapiezimmer vor. Psychotherapeut*innen vermitteln sie günstig oder ungünstig und Patient*innen bringen ihre ungünstigen Suggestionen mit. Mit deren Effekten arbeitet explizit die Hypnotherapie.

- Details
- Geschrieben von: Jürgen Junglas
- Kategorie: Anne M. Lang
- Zugriffe: 4988
Anne M. Lang
Vortrag 6.5.2023, Siegburg: 28. Rheinische Allgemeine PSYCHOtherapietagung - Psychotherapie nach der Zeitenwende
Systemische Therapie - Richtlinie und Fachkunde
Schon 2008 wurde Systemische Therapie vom Wissenschaftlichen Beirat anerkannt, der die Wissenschaftlichkeit der PT-Verfahren für den Gesetzgeber prüft. 2018 erkannte dann der Gemeinsame Bundesauschuss, G-BA, Systemische Therapie als 4. Richtlinienverfahren an und brachte es so in die Therapielandschaft ein.
Seit 2021 ist sie im Gesundheitswesen präsent und wird auch als Fachkunde zur Approbation gelehrt. Aktuell besteht noch kollegialer Informationsbedarf, was ST neu einbringt, bzw. wie sie Psychotherapie versteht und ausübt. Auch steckt ihre Vermittlung und Ausübung in einem bereits vorgeprägten Gesundheitssystem noch in den Kinderschuhen.
Die hier folgenden wörtlichen Zitate aus dem Gutachten des G-BA werden im Impulsvortrag des Blockes als Thesen eingebracht.
Aus dem Gutachten: www.g-ba.de
„Die Systemische Therapie fokussiert den sozialen Kontext psychischer
Störungen und misst dem interpersonellen Kontext eine besondere ätiologische
Relevanz bei.
Symptome werden als kontraproduktiver Lösungsversuch psychosozialer und psychischer Probleme verstanden, die wechselseitig durch intrapsychische (kognitiv-emotive), biologisch-somatische sowie interpersonelle Prozesse beeinflusst sind.
Theoretische Grundlage sind insbesondere die Kommunikations- und Systemtheorien, konstruktivistische und narrative Ansätze
und das biopsychosoziale Systemmodell.
Grundlage für Diagnostik und Therapie von psychischen Störungen im Sinne dieser Richtlinie ist die Analyse der Elemente der jeweiligen relevanten Systeme und ihrer wechselseitigen Beziehungen, sowohl unter struktureller als auch generationaler Perspektive und eine daraus abgeleitete Behandlungsstrategie.
Der Behandlungsfokus liegt in der Veränderung von symptomfördernden, insbesondere familiären und sozialen Interaktionen, narrativen
und intrapsychischen Mustern hin zu einer funktionaleren Selbst-Organisation der
Patientin oder des Patienten und des für die Behandlung relevanten sozialen
Systems, wobei die Eigenkompetenz der Betroffenen genutzt wird.
Schwerpunkte der systemischen Behandlungsmethoden sind insbesondere
− Methoden der systemischen Gesprächsführung und
Systemische Fragetechniken
− Narrative Methoden
− Lösungs- und ressourcenorientierte Methoden
− Strukturell-strategische Methoden
− Aktionsmethoden
− Methoden für die Arbeit am inneren System
− Methoden zur Affekt- und Aufmerksamkeitsregulation
− Symbolisch- metaphorische und expressive Methoden.
(1) Psychotherapie gemäß § 15 dieser Richtlinie kann in folgenden Formen
Anwendung:
1. Einzeltherapie mit einer einzelnen Patientin oder einem einzelnen Patienten.
2. Gruppentherapie mit mindestens drei bis höchstens neun Patientinnen und
Patienten, sofern die Interaktion zwischen mehreren Patientinnen und Patienten
therapeutisch förderlich ist und die gruppendynamischen Prozesse entsprechend
genutzt werden sollen.
3. Systemische Therapie kann auch im Mehrpersonensetting Anwendung finden.“